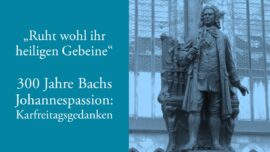Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Johannes-Passion, die am 7. April 1724 zum ersten Mal in der Leipziger Nikolai-Kirche aufgeführt wurde, “schlug wie ein Komet ein”, wie der Bach-Forscher Martin Geck (1936-2019) in seiner Biografie feststellte. Erst wenige Jahre vorher, wurde die musikalische Ausgestaltung des Karfreitags in Leipzig verändert und größere, anspruchsvollere Werke möglich. Mit seiner ersten Passion setzte Bach die Marke gleich ganz weit oben an. Es selbst sollte diese dann drei Jahre später durch seine Matthäus-Passion noch überbieten. Dennoch hat auch gerade die Johannes-Passion ihre Fans. Der Komponist Robert Schumann (1810-1856) bevorzugt sie gegenüber der Matthäus-Passion. Die Wiederaufführung der Matthäus-Passion in Berlin im Jahr 1829 durch Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) hatte auch dazu geführt, dass die Johannes-Passion im Jahr 1832 wieder erklang. In seiner Komposition hat Bach die Passionserzählung aus dem Johannes-Evangelium durch Arien und Choräle unterbrochen. Sie antworten, kommentieren und aktualisieren das Wort der Schrift. Dazu die Musik. All das ist ein Ausdruck von Bachs Spiritualität, der uns heute noch ansprechen kann. Entsprechend wird die Johannes-Passion jedes Jahr in vielen Kirchen und Konzertsälen zur Aufführung gebracht.
Über die Johannes-Passion wird auch kontrovers diskutiert. Bach hat den johanneischen Evangeliums-Text vertont und damit auch die Passagen, die antijüdischen Charakter haben. Macht die Passionserzählung klar, “die Juden” seien Schuld am Tod Jesu, so weisen die Choräle der Passionsmusik in eine andere Richtung. Hier ist es das Ich, welches die Schuld trägt. Im Jahr 2012 wurde in Berlin ein Fassung der Johannes-Passion aufgeführt, in der die judenfeindlichen Texte ausgetauscht waren. Das führt zu der Frage, wie umgehen mit dem judenfeindlichen Erbe des Christentums? Geht man mit wachem Auge durch unsere Kirchen findet man dort Schmähplastiken, Glasfenster oder Altarbilder mit entsprechenden Darstellungen. Gerade über das “Judensau”-Relief an Martin Luthers (1483-1547) Predigtkirche in Wittenberg wird heftig gestritten. Mit erklärenden Worte und einen Mahnmal wird die Darstellung an der Außenwand der Stadtkirche eingeordnet. Viele andere Kirchen sind diesem Weg gefolgt. Aber auch im Gottesdienst gibt es schwierige Passagen und eben auch in der Kirchenmusik. Gerade in Zeiten, in denen sich Hass und Feindschaft wieder verstärkt gegen jüdischen Menschen wendet, ist es umso wichtiger, darauf aufmerksam zu machen. Wenn wir die Johannes-Passion aufführen, dann müssen wir auch jeden Mal über unsere christliche judenfeindliche Haltung reden. Uns zu unserer Schuld bekennen und deutlich machen, wie falsch eine solche Haltung ist.
RJ